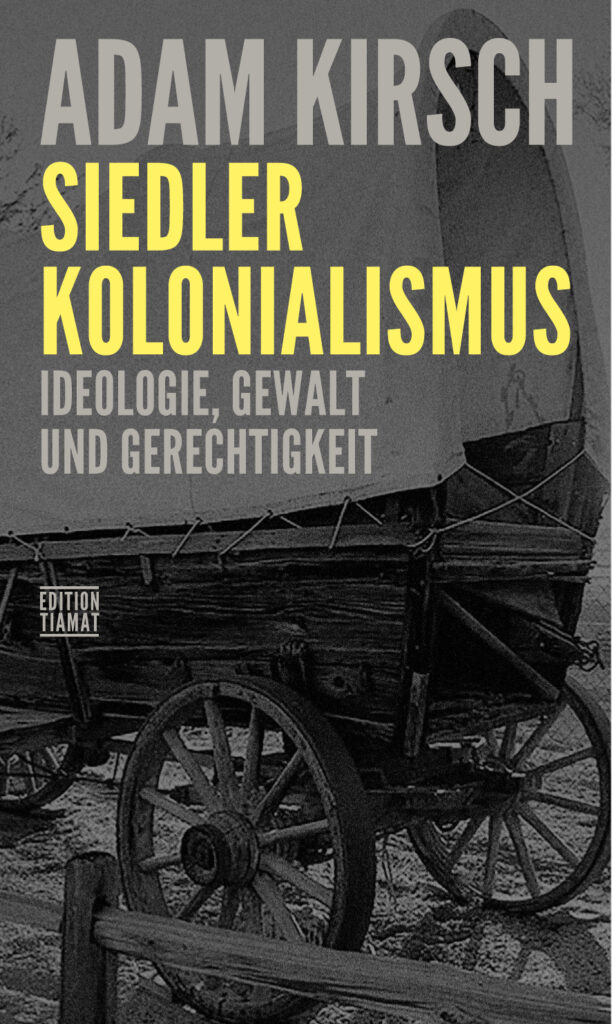
In seinem Buch „Siedlerkolonialismus: Ideologie, Gewalt und Gerechtigkeit“ beschäftigt sich der Autor Adam Kirsch mit einem Begriff, der in den letzten Jahren immer häufiger verwendet wird: Siedlerkolonialismus. Der Ausdruck mag auf den ersten Blick sperrig und akademisch wirken, doch die dahinterstehende Idee hat direkte Auswirkungen auf unser Verständnis von Geschichte, Gerechtigkeit – und auf aktuelle politische Konflikte.
Kirsch zeigt, dass es beim Siedlerkolonialismus nicht nur um alte Kolonialmächte wie Großbritannien oder Frankreich geht, sondern um eine spezielle Form der Kolonisierung. Anders als klassische Kolonialherren, die etwa Rohstoffe aus fremden Ländern herausholten, wollen Siedlerkolonialisten das besetzte Land selbst dauerhaft in Besitz nehmen – und oft die ursprüngliche Bevölkerung verdrängen oder sogar auslöschen.
Was ist Siedlerkolonialismus?
Siedlerkolonialismus bedeutet, dass Menschen aus einem Land in ein anderes Gebiet einwandern, es sich dauerhaft aneignen und dort eine neue Gesellschaft aufbauen – meist ohne Rücksicht auf die Rechte der Menschen, die dort ursprünglich gelebt haben. Dieses Vorgehen ist mit Gewalt, Verdrängung und Ungerechtigkeit verbunden.
Bekannte Beispiele dafĂĽr sind:
- Die Besiedlung Nordamerikas durch Europäer, bei der indigene Völker systematisch unterdrückt und vertrieben wurden.
- Die GrĂĽndung Australiens als Strafkolonie, bei der Aborigines entrechtet wurden.
- Die weiße Besiedlung Südafrikas mit jahrhundertelanger Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung.
Der Staat Israel und das neue Verständnis von Siedlerkolonialismus
Kirsch geht in seinem Buch auf eine neue Diskussion ein, die besonders heftig und umstritten ist: Manche Kritiker sehen auch den Staat Israel als Beispiel für Siedlerkolonialismus. Der Vorwurf lautet, dass jüdische Einwanderer aus Europa nach Palästina kamen, dort einen eigenen Staat gründeten und dabei die arabische Bevölkerung verdrängten.
Dieser Blickwinkel ist hoch umstritten – sowohl politisch als auch moralisch. Für viele Menschen ist Israel ein Zufluchtsort für jüdische Menschen nach dem Holocaust. Für andere ist es ein Beispiel für ein System, das auf der Entrechtung der palästinensischen Bevölkerung basiert. Kirsch beschreibt diese Sichtweise nicht als persönliche Meinung, sondern zeigt, wie sich die Debatte entwickelt hat und welche Gedanken dahinterstehen.
Ideologie und Gewalt
Ein zentrales Thema des Buches ist die Rolle der Ideologie im Siedlerkolonialismus. Wer Land erobert und besiedelt, braucht eine Rechtfertigung dafür – sei es religiöser Glaube, Rassentheorien oder das Gefühl, einer „zivilisierten“ Kultur anzugehören. Kirsch erklärt, wie solche Ideologien entstehen und wie sie Gewalt nicht nur ermöglichen, sondern oft sogar als notwendig erscheinen lassen.
Dabei geht es auch um die Sprache der Macht: Wenn Siedler von „leeren“ Ländern sprechen oder von „Wilden“, die keine „richtige“ Kultur haben, dann wird die Unterdrückung verschleiert oder gerechtfertigt. Die eigentliche Gewalt beginnt nicht erst mit Waffen, sondern schon mit der Art, wie Menschen über andere denken und sprechen.
Gerechtigkeit – ein schwieriges Thema
Wie lässt sich mit einer solchen Vergangenheit umgehen? Was bedeutet Gerechtigkeit in einem Kontext, in dem das Unrecht schon vor Jahrhunderten begonnen hat? Kirsch diskutiert verschiedene Ansätze – von Entschädigungen bis zu Rückgabe von Land – und zeigt, wie kompliziert die Suche nach Gerechtigkeit sein kann. Vor allem dann, wenn neue Gesellschaften längst gewachsen sind und Menschen dort leben, die selbst keine Täter, aber auch nicht unschuldig sind.
Kirsch stellt keine einfachen Lösungen vor. Er zeigt, dass jede Form von Gerechtigkeit mit schwierigen Fragen verbunden ist: Wer darf bleiben? Wer muss gehen? Wie weit reicht historische Schuld? Und was ist mit Menschen, die im Glauben handeln, etwas Richtiges zu tun?
Fazit: Ein Buch, das zum Nachdenken anregt
„Siedlerkolonialismus: Ideologie, Gewalt und Gerechtigkeit“ ist ein anspruchsvolles, aber wichtiges Buch. Es geht nicht darum, einzelne Länder oder Gruppen zu verurteilen. Vielmehr fordert Kirsch uns dazu auf, genauer hinzuschauen: Was passiert, wenn Menschen sich ein Land aneignen, das anderen gehört? Welche Rolle spielt dabei unsere Geschichte? Und wie können wir heute mit diesen schwierigen Fragen umgehen?
Durch das Nachwort von Tim Stosberg und die Übersetzung von Christoph Hesse wird das Buch auch für deutschsprachige Leser:innen zugänglich. Es ist kein leichter Stoff – aber ein notwendiger, gerade in einer Welt, in der Fragen von Land, Herkunft und Gerechtigkeit wieder zentral geworden sind.
- Herausgeber ‏ : ‎ edition TIAMAT
- Erscheinungstermin ‏ : ‎ 17. März 2025
- Auflage ‏ : ‎ 1.
- Sprache ‏ : ‎ Deutsch
- Seitenzahl der Print-Ausgabe ‏ : ‎ 200 Seiten
- ISBN-10 ‏ : ‎ 3893203257
- ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3893203253
- Originaltitel ‏ : ‎ Settlercolonialism
- Abmessungen ‏ : ‎ 12.5 x 2 x 21 cm
- 24 Euro
