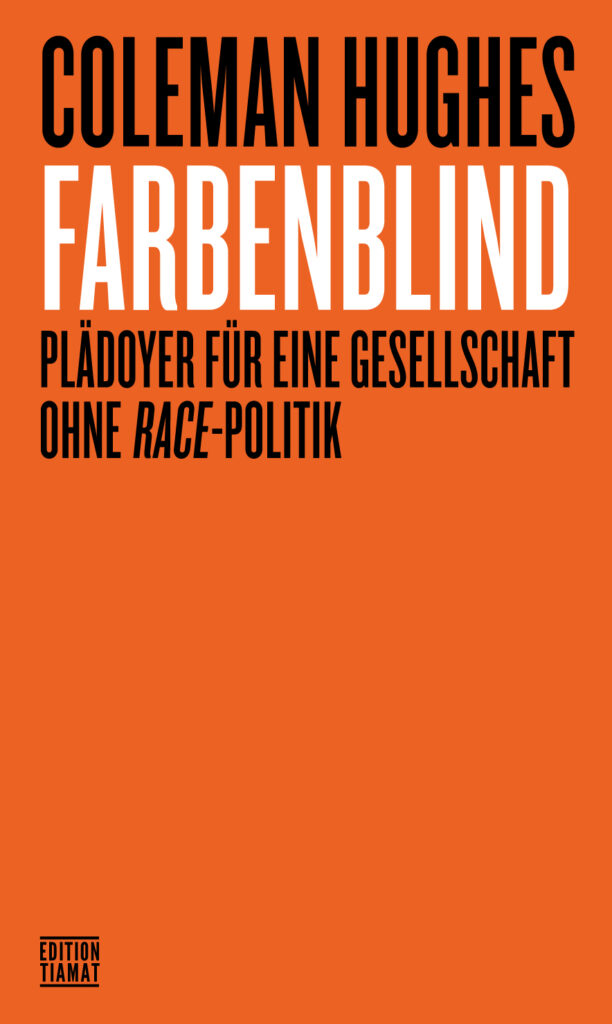
Coleman Hughes ist ein junger amerikanischer Autor und Philosoph, der sich seit Jahren mit den Themen Rassismus, IdentitûÊtspolitik und Bû¥rgerrechte beschûÊftigt. In seinem Buch ãFarbenblind: PlûÊdoyer fû¥r eine Gesellschaft ohne Race-Politikã setzt er sich kritisch mit einer StrûÑmung auseinander, die in den USA und zunehmend auch in Europa an Bedeutung gewonnen hat: dem sogenannten ãneuen Antirassismusã.
Diese Bewegung vertritt die Auffassung, dass die Gesellschaft unû¥berwindbar von Rassenunterschieden geprûÊgt sei. Weiûe Menschen wû¥rden grundsûÊtzlich vom Rassismus profitieren, wûÊhrend Schwarze und andere Minderheiten stets Opfer davon seien. Aus dieser Sicht sei es unmûÑglich, die Unterschiede zwischen den Gruppen zu û¥berbrû¥cken. Versuche, Brû¥cken zu bauen oder Gemeinsamkeiten zu betonen, wû¥rden daher sogar als gefûÊhrlich und schûÊdlich abgelehnt.
Hughes hûÊlt diese Haltung fû¥r problematisch. Er erinnert daran, dass die klassische amerikanische Bû¥rgerrechtsbewegung der 1950er- und 1960er-Jahre ein ganz anderes Ideal verfolgte: nûÊmlich Farbenblindheit. Damit ist gemeint, dass Hautfarbe oder Herkunft keine Rolle bei der Bewertung eines Menschen spielen sollten. Martin Luther King trûÊumte bekanntlich von einer Gesellschaft, in der Menschen nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. Hughes sieht in diesem Ideal keinen naiven Wunsch, sondern eine notwendige Grundlage fû¥r ein friedliches und gerechtes Zusammenleben.
Das Buch zeigt anhand vieler Beispiele, wie die Abkehr von dieser Haltung zu neuen Problemen fû¥hrt. Programme in Unternehmen oder UniversitûÊten, die Menschen nach Hautfarbe bevorzugen oder benachteiligen, mûÑgen gut gemeint sein, schaffen aber neue Ungerechtigkeiten. So kann es vorkommen, dass Bewerber nicht nach Leistung, sondern nach ihrer ãRaceã beurteilt werden. Hughes hûÊlt das fû¥r eine Form von Diskriminierung, auch wenn sie als Korrektur vergangener Benachteiligungen gemeint ist.
Er beschreibt auch FûÊlle, in denen politische Entscheidungen ã etwa in der Medizin oder Bildung ã explizit nach Rassenkategorien getroffen werden. Dabei kûÑnnen Menschen im Einzelfall benachteiligt werden, nur weil sie der ãfalschenã Gruppe angehûÑren. Nach seiner Auffassung ist dies nicht nur unfair, sondern untergrûÊbt auch das Vertrauen zwischen den Gruppen.
Ein weiteres Thema des Buches ist die Wirkung dieser neuen Politik auf Schwarze selbst. Hughes argumentiert, dass sie durch die stûÊndige Betonung von Opferrollen und vermeintlichen SchwûÊchen in eine stereotype Position gedrûÊngt werden. Wer Menschen immer wieder einredet, sie seien durch Hautfarbe besonders verletzlich oder emotional instabil, nimmt ihnen die MûÑglichkeit, als eigenstûÊndige, starke Individuen aufzutreten.
Der Autor schreibt in einem klaren, direkten Stil. Er vermeidet komplizierte Fachsprache und legt Wert darauf, dass auch Leserinnen und Leser ohne philosophischen Hintergrund seinen Gedanken folgen kûÑnnen. Gleichzeitig ist sein Ton leidenschaftlich, manchmal polemisch, wenn er aufzeigt, wie widersprû¥chlich und schûÊdlich bestimmte Formen der IdentitûÊtspolitik sind.
Hughesã zentrales Anliegen ist die Rû¥ckkehr zu einer Politik und Kultur, die Menschen als Einzelne sieht ã nicht als Vertreter einer Hautfarbe. Er glaubt, dass nur so eine wirklich gerechte Gesellschaft entstehen kann, in der alle Menschen die gleichen Chancen haben und in der Vertrauen an die Stelle von Misstrauen tritt.
Das Buch versteht sich damit als ein PlûÊdoyer fû¥r eine Gesellschaft ohne Race-Politik. Es ist kein Ruf nach Gleichgû¥ltigkeit gegenû¥ber Diskriminierung ã Hughes leugnet nicht, dass Rassismus existiert. Aber er betont, dass man ihn nicht bekûÊmpfen kann, indem man neue Formen von Trennung und Einteilung nach Rassen schafft. Stattdessen soll man den Menschen in den Mittelpunkt stellen, nicht seine Hautfarbe.
Mit ãFarbenblindã legt Coleman Hughes einen Beitrag zur aktuellen Debatte û¥ber Rassismus, Antirassismus und IdentitûÊtspolitik vor, der bewusst gegen den Zeitgeist argumentiert. Es ist ein Buch, das provozieren will, aber auch Hoffnung macht: die Hoffnung auf eine Gesellschaft, in der wir uns nicht durch ûÊuûere Merkmale definieren, sondern durch unsere Handlungen, unseren Charakter und unsere Menschlichkeit.
Zusammenfassung
ãFarbenblindã von Coleman Hughes fordert eine Rû¥ckkehr zur Idee, Menschen ohne Rû¥cksicht auf ihre Hautfarbe zu behandeln. Anstatt ã wie im Radikalen Neorassismus ã stets Rasse, Macht und strukturelle Ungleichheit in den Vordergrund zu stellen, plûÊdiert er dafû¥r, Menschen als Individuen zu sehen. Er warnt vor den Nebenwirkungen einer identitûÊtspolitischen Denkweise ã etwa selektive FûÑrderung, stereotype Zuschreibungen oder Umkehrdiskriminierung. Spannende Beispiele zeigen, wie solche Praktiken oft kontraproduktiv sind. Hughes schreibt klar und argumentativ mit einem tiefen Bezug zur Bû¥rgerrechtsbewegung. Kritiker sehen darin eine wichtige Stimme, monieren aber SchwûÊchen ã etwa bei der Behandlung des Antisemitismus.
ãFarbenblindã von Coleman Hughes ist ein kluges, klar geschriebenes und mutiges Buch. Es zeigt, warum eine Gesellschaft ohne Rassenpolitik gerechter und menschlicher wûÊre. Mit starken Beispielen und û¥berzeugender Argumentation erinnert es an die Ideale der Bû¥rgerrechtsbewegung ã aktuell, inspirierend und sehr lesenswert.
- Herausgeber ã : ã edition TIAMAT
- Erscheinungstermin ã : ã 17. MûÊrz 2025
- Auflage ã : ã New
- Sprache ã : ã Deutsch
- Seitenzahl der Print-Ausgabe ã : ã 264 Seiten
- ISBN-10 ã : ã 3893203249
- ISBN-13 ã : ã 978-3893203246
- Originaltitel ã : ã The end of race politics
- Abmessungen ã : ãô 12.5 x 25 x 21 cm
- 26 Euro
