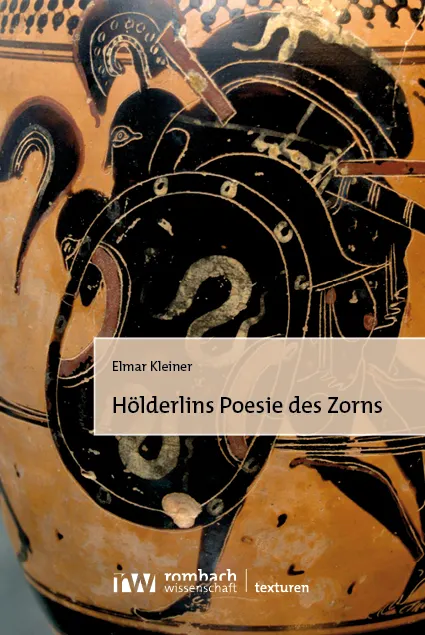
Ein flammender Blick in die Tiefen der Dichtung – wenn Zorn zur Poesie wird, und Poesie zum Aufschrei der Seele.
Elmar Kleiner gelingt mit Hölderlins Poesie des Zorns nicht weniger als eine literaturwissenschaftliche Sensation. Was sich in nüchterner Form als „neue Perspektive“ auf das Werk des großen Dichters Hölderlin ankündigt, entpuppt sich bei der Lektüre als furiose, klarsichtige und gleichzeitig emotional bewegende Auseinandersetzung mit einem der kraftvollsten Affekte des menschlichen Daseins: dem Zorn.
Und dieser Zorn ist keine Randnotiz, keine schillernde Metapher, kein bloßes Stilelement in der Dichtung Hölderlins. Nein – in Kleiners Deutung ist er Grundton, Treibstoff, Herzschlag.
Zorn – mehr als Metapher: Eine Revolution des Deutens
Bisher wurde Hölderlins Zorn oft beschwichtigt, verkleidet als dichterische Begeisterung, als „dämonische Inspiration“, als Leidenschaft, die vergeistigt zu werden hatte. Elmar Kleiner kehrt diese Tradition mit energischer Entschlossenheit um. Sein Ansatz ist mutig, eigenständig und dabei stets tief verwurzelt in philologischer Genauigkeit und historischer Kontextualisierung.
Was er zeigt, ist kein allegorischer Zorn, kein ornamentaler Affekt. Es ist der wahrhaftige, menschliche, leidenschaftliche Zorn eines Dichters, der Zeit, Welt und Göttern gegenübersteht – und nicht schweigt.
Vom Jugendwerk bis zum Turm – ein roter Faden der Glut
Kleiner verfolgt die Linie des Zorns durch das gesamte Werk Hölderlins. In den Jugendgedichten lodert er noch ungestüm und unmittelbar. Später, in der Zeit der großen Hymnen und Oden, nimmt der Zorn strukturierte Formen an – er wird politisch, mythisch, philosophisch. Und schließlich, in den sogenannten „Turmgedichten“, jenen späten Texten, die Hölderlin im Rückzug aus der Welt schrieb, flammt er erneut auf – nun als stiller, existenzieller Protest gegen das Verstummen der Götter, gegen das Versagen der Welt, gegen das Verstummen der Dichtung selbst.
So entsteht bei Kleiner ein literarisches Psychogramm, das nicht auf Spekulation, sondern auf philologischer Präzision und interdisziplinärer Weitsicht fußt.
Zorn und Theorie: Aristoteles – und darüber hinaus
Zentrales Fundament dieser bahnbrechenden Arbeit ist die Auseinandersetzung mit der Zorntheorie des Aristoteles, wie sie in der Rhetorik entfaltet wird. Doch Kleiner geht weiter: Er verzahnt die antike Theorie mit den historischen und politischen Umbrüchen zur Zeit Hölderlins – mit der Französischen Revolution, der Napoleonischen Epoche, der deutschen Restauration.
Der Zorn, den Kleiner bei Hölderlin sichtbar macht, ist nicht bloß innerlich, nicht bloß mythologisch: Er ist auch revolutionär. Er ist der Zorn einer Seele, die nicht in romantischer Schwärmerei versinkt, sondern sich auflehnt – gegen Ungerechtigkeit, gegen politische Unterdrückung, gegen das Zerbrechen des Ideals an der Wirklichkeit.
So wird Hölderlin in diesem Buch nicht zum isolierten Genie verklärt, sondern als Zeitzeuge und Zeitkritiker neu gelesen – ein Dichter, der sich aus dem Brennglas der Geschichte heraus meldet, mit der unmissverständlichen Stimme des Zorns.
Achill, Ajax, Ödipus – mythologische Spiegel des Affekts
Immer wieder tauchen in Hölderlins Werk Gestalten der antiken Tragödie auf: Achill, der zornige Krieger; Ajax, der in Wahnsinn und Verzweiflung endet; Ödipus, der sein Schicksal erkennt und daran zerbricht.
Kleiner versteht es meisterhaft, diese Figuren nicht nur als Referenzen, sondern als Zorn-Exempel zu lesen. In ihnen spiegeln sich die inneren Spannungen Hölderlins, seine Kämpfe, seine Visionen und seine Erschütterungen. Der Mythos wird bei Hölderlin zur Bühne der Seele – und Kleiner zeigt, wie eng dabei Affekt, Ästhetik und Philosophie verwoben sind.
Stilistisch kraftvoll, intellektuell brillant
Elmar Kleiner schreibt mit einer Klarheit und Leidenschaft, die selten geworden ist in der akademischen Literatur. Er verliert sich nie in Fachjargon, sondern trifft mit jedem Kapitel, jedem Abschnitt, jedem Gedanken den Nerv. Seine Sprache ist durchdrungen von dem Zorn, den er beschreibt – nicht wütend, nicht aggressiv, sondern dringlich, leidenschaftlich, lebendig.
Dieses Buch liest sich nicht wie eine bloße literaturwissenschaftliche Abhandlung. Es liest sich wie eine Rückgewinnung – der Intensität, der existenziellen Tiefe, der brennenden Relevanz von Hölderlins Werk.
Ein Werk mit Nachhall
Hölderlins Poesie des Zorns ist kein Buch, das man nach der letzten Seite einfach weglegt. Es hallt nach. Es verändert den Blick. Es zwingt zur Wiederbegegnung mit einem Dichter, der vielen als entrückt, vergeistigt oder gar unverständlich galt – und nun, in Kleiners Deutung, mit leuchtenden Augen und bebendem Atem zurückkehrt.
Fazit: Ein intellektuelles Ereignis
Dieses Buch ist mehr als eine Interpretation – es ist ein Ereignis.
Ein leidenschaftlicher Appell, Dichtung neu zu lesen.
Ein Triumph der philologischen Intuition und historischen Tiefe.
Ein Fanal gegen die Glättung großer Literatur.
Wer Hölderlin liebt – oder glaubt, ihn zu kennen – wird hier überrascht.
Wer ihn noch nie verstanden hat, wird ihn erkennen.
Und wer glaubt, Zorn sei kein poetisches Thema,
der wird hier eines Besseren belehrt –
auf furiose, erschĂĽtternde, wunderbare Weise.
Ein außergewöhnliches Buch! Elmar Kleiner eröffnet eine völlig neue Sicht auf Hölderlin – kraftvoll, klug und tiefgründig. Der Zorn als zentrales Motiv wird hier nicht romantisiert, sondern als existenzielles Gefühl analysiert. Eine mutige, brillante Studie, die Literatur, Philosophie und Geschichte vereint.
- Herausgeber ‏ : ‎ Nomos
- Erscheinungstermin ‏ : ‎ 3. Mai 2024
- Auflage ‏ : ‎ 1.
- Sprache ‏ : ‎ Deutsch
- Seitenzahl der Print-Ausgabe ‏ : ‎ 413 Seiten
- ISBN-10 ‏ : ‎ 3988580694
- ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3988580696
- Abmessungen ‏ : ‎ 15.6 x 23.1 x 2.6 cm
- 109 Euro
