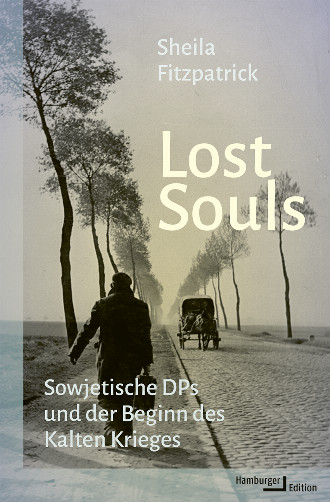
Das Buch Lost Souls: Sowjetische DPs und der Beginn des Kalten Krieges erzÃĊhlt eine weitgehend vergessene Geschichte, die direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann. Es geht um Menschen, die aus der Sowjetunion stammten und sich nach 1945 in Deutschland und Ãsterreich wiederfanden â weit weg von ihrer Heimat, ohne zu wissen, wohin sie gehörten. Diese Menschen nannte man Displaced Persons, kurz DPs. Das bedeutet wörtlich âvertriebene Personenâ.
Etwa eine Million sowjetische DPs lebten in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands und Ãsterreichs. Viele von ihnen waren Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die wÃĊhrend des Krieges nach Deutschland verschleppt worden waren. Andere stammten aus Gebieten wie der Westukraine, Estland, Lettland oder Litauen â Regionen, die 1939 und 1940 gewaltsam in die Sowjetunion eingegliedert worden waren. Manche dieser Menschen hatten Angst vor der RÃỳckkehr in die Sowjetunion, weil sie dort als âVerrÃĊterâ galten oder Repressionen befÃỳrchteten. Andere hatten schlicht kein Zuhause mehr, zu dem sie zurÃỳckkehren konnten.
Fitzpatrick beschreibt, dass die Situation dieser Menschen nach 1945 sehr kompliziert war. ZunÃĊchst galten sie als Opfer des Krieges und des Nationalsozialismus, und internationale Hilfsorganisationen â besonders die UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) â kÃỳmmerten sich um sie. Doch bald ÃĊnderte sich die politische Stimmung. Die Fronten zwischen Ost und West verhÃĊrteten sich, und die sowjetische Regierung verlangte, dass alle sowjetischen BÃỳrgerinnen und BÃỳrger in die Heimat zurÃỳckgeschickt werden mÃỳssten. FÃỳr Moskau waren sie âDeserteureâ oder âVerrÃĊterâ, die man wieder unter Kontrolle bringen wollte.
Viele DPs weigerten sich jedoch, zurÃỳckzukehren. Sie wussten, dass sie dort Verhöre, Lagerhaft oder Schlimmeres erwarteten. Diese Weigerung wurde zu einem brennenden politischen Thema zwischen der Sowjetunion und den westlichen Alliierten. Fitzpatrick zeigt, wie aus einer humanitÃĊren Frage â nÃĊmlich, was mit den Vertriebenen geschehen soll â plötzlich ein politischer Machtkampf wurde.
Ab 1947 ÃĊnderte sich die Wahrnehmung dieser Menschen im Westen. Sie galten nun nicht mehr nur als Opfer des Krieges, sondern zunehmend als âOpfer des Kommunismusâ. Das passte in die wachsende ideologische Auseinandersetzung zwischen Ost und West â den Kalten Krieg. FÃỳr die Vereinigten Staaten war es eine Gelegenheit, ihre politische Botschaft zu verbreiten: Sie wollten zeigen, dass Menschen freiwillig aus dem sowjetischen System flohen, weil sie dort keine Freiheit hatten.
Die US-Regierung begann, Programme zur Umsiedlung dieser Menschen in LÃĊnder wie Amerika, Kanada, Australien oder andere Staaten auÃerhalb Europas zu unterstÃỳtzen. Viele DPs nahmen diese Chance wahr â sie begannen ein neues Leben in der Fremde, oft unter schwierigen Bedingungen.
Die Sowjetunion protestierte heftig gegen diese Umsiedlungen und bezeichnete sie als âDiebstahl sowjetischer BÃỳrgerâ. Fitzpatrick beschreibt, wie sich hinter den Kulissen ein intensiver diplomatischer Kampf entwickelte. Es ging nicht nur um Menschen, sondern auch um Symbole, um politische Deutungshoheit.
Das Buch zeigt eindrucksvoll, wie sich das Leben der DPs in den Lagern gestaltete. Sheila Fitzpatrick stÃỳtzt sich dabei auf neue Archivfunde, persönliche Briefe und Interviews. Sie schildert, wie die Menschen ihren Alltag organisierten, Schulen grÃỳndeten, Theater spielten oder Zeitungen herausgaben. In dieser Zwischenwelt zwischen Vergangenheit und Zukunft entwickelten sie neue Gemeinschaften â manchmal geprÃĊgt von Hoffnung, manchmal von EnttÃĊuschung.
Fitzpatrick gelingt es, Geschichte aus zwei Perspektiven zu erzÃĊhlen:
- aus der Sicht der groÃen Politik, in der die USA und die Sowjetunion um Einfluss rangen,
- und aus der Sicht der einfachen Menschen, die nach Jahren des Krieges endlich Frieden und Sicherheit suchten.
Das Buch macht deutlich, dass Flucht immer mit Leid, Verlust und Angst verbunden ist â aber auch mit der Kraft, neu anzufangen. Viele der sowjetischen DPs schafften es, sich in ihren neuen LÃĊndern ein Leben aufzubauen. Manche wurden sogar zu wichtigen Stimmen in der antikommunistischen Bewegung, andere versuchten einfach, die Vergangenheit hinter sich zu lassen.
Trotz aller Tragik sieht Fitzpatrick in ihrer Geschichte auch eine Erfolgsgeschichte. Sie zeigt, dass Migration und Neubeginn Teil der europÃĊischen Nachkriegswirklichkeit waren â und dass diese Erfahrungen uns auch heute etwas sagen können.
Denn auch in der Gegenwart stellt sich immer wieder die Frage, wie Gesellschaften mit GeflÃỳchteten umgehen, welche Verantwortung Staaten tragen und wie Politik Ãỳber Menschlichkeit entscheidet. Fitzpatricks Buch erinnert daran, dass hinter jeder Fluchtgeschichte individuelle Schicksale stehen â Menschen, die nicht nur Opfer der UmstÃĊnde sind, sondern auch Gestalter ihrer Zukunft.
ChatGPT:
Ein beeindruckendes Buch! Lost Souls vermittelt mit viel Empathie und historischer Genauigkeit das Schicksal sowjetischer Displaced Persons nach dem Zweiten Weltkrieg. Spannend, berÃỳhrend und zugleich lehrreich â ein wichtiger Beitrag zum VerstÃĊndnis von Flucht und Neubeginn.
- Herausgeber â : â Hamburger Edition
- Erscheinungstermin â : â 15. September 2025
- Auflage â : â 1.
- Sprache â : â Deutsch
- Seitenzahl der Print-Ausgabe â : â 400 Seiten
- ISBN-10 â : â 3868548777
- ISBN-13 â : â 978-3868548778
- Abmessungen â : â 15.1 x 3.4 x 21.8 cm
- 40 Euro
